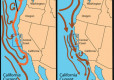Den letzten Abend in Port Townsend verbringen wir mit unseren Seglerfreunden Jennifer und John, die nun endlich von Alaska wieder nach Hause gekommen sind. John springt nervös vom Sofa. Er hat soeben eine Anfrage von einem Bekannten aus Kanada erhalten, ob er nach San Franzisco segeln wolle. Na perfekt. So sind wir nun zwei Yachten mit dem selben Ziel. Drew wird die nächsten Tage in die USA einreisen. Die Grenze ist für den Freizeitverkehr noch immer zu. Wir sind zuversichtlich. Er wird, wie von uns empfohlen, einen Bogen um Friday Harbor segeln und in Port Angeles einklarieren. Ich denke bei uns allen hat es geklappt, weil wir nach Mexiko wollten und somit die Reise unter Transit läuft.
Paar Tage später tut sich das lang ersehnte Wetterfenster auf. Ich schätze es, die bevorstehende Herausforderung mit zwei erfahrenen, ortskundigen Segler zu planen. Sie leihen uns einen tollen Segelführer aus. Charlies Charts, US Pacific Coast. Den werde ich ihnen von San Diego wieder zurück schicken. Weiter nutzen wir den US Coast Pilot Nummer 7 und 10.
Diese Küste ist schon so manchem Seefahrer zum Verhängnis geworden. Die starken Strömungen machen diese Küste so gefährlich. Auf Grund der gegenläufigen Hauptströmungen mischt sich kaltes Oberflächenwasser aus Nord mit dem warmen Wasser aus Süd, was die See gut aufmischt. Zusammen mit dem Wind herrschen oft Wind gegen Strom Verhältnisse was zusätzlich eine steile hackige See verursacht. Vor den Häfen liegen Sandbarren die nur in ruhigen Bedingungen oder allenfalls nur mit Hilfe der Küstenwache angefahren werden dürfen. Diese vermeintlich sicheren Orte werden schnell mal aus Sicherheitsgründen von der Coast Gard geschlossen.. Crescent City ist der einzige Hafen der immer offen ist. Cape Mendosino ist ein weiterer Knackpunkt auf dieser Strecke. Dort pustet es auch immer kräftig. Die beste Zeit um dieser Küste entlang zu segeln ist Sommer bis Mitte September. Ab Herbst ziehen die aus West über den Pazifik reinlaufenden Tiefs immer südlicher durch und bringen starken Südwind.
Rückblickend sind wir zu spät los. Wir beide haben schon so manche Seemeilen unterm Kiel, doch diese Überfahrt geht in die Kategorie schlimm – jedenfalls für mich! Unsere Freunde wollten uns folgen. Doch der Nordwind hat sich wohl bis nächsten Sommer verabschiedet. Schade.
Letzter Sicherheitscheck steht an: Das Gefährt muss in bestem Zustand sein! Motor wird eingehend unter die Lupe genommen, Rigg kontrollieren, dabei muss jemand auf den Mast klettern, um alle Wanten nach fehlenden Splinten oder anderen Schäden zu überprüfen. Vor allem den Splinten traue ich nicht mehr, obwohl sie längst allesamt ausgetauscht sind. Die vom AWN in Neuseeland sind absolute Schundware! Gummis der Luken habe ich letzte Woche schon in Silikon eingeweicht damit alle Fenster bestimmt dicht sind. Schwerwetterklamotten, Schwimmwesten mit Sicherheitsleinen und warme Pullis sind einsatzbereit. Wasser und Diesel sind getankt, Proviant und alles was rumfliegen oder klappern kann ist ordentlich verstaut.
Alles scheint perfekt.
Geplant ist, die rund 700 Seemeilen ohne Zwischenhalt bis nach San Francisco durchzusegeln. Stecken einen Kurs von mindestens 60 Seemeilen von der Küste entfernt ab, um so dem Frachtverkehr und den lokalen Krabbenfischern auszuweichen. Der Nachteil, weiter draussen ist die See unruhiger.
In der Straight of Juan de Fuca, der Meerenge zwischen Kanada und den USA, fegen heftige Böen von den Berghängen herunter. In der Naeh Bay, einer kleinen „First Nation Siedlung“, die wegen Covid19 gegen aussen abgeschottet ist, verbringen wir die Letzte Nacht vor dem Absprung ohne Landgang. Eine unruhige Nacht. Der Ankergrund ist mies und die heftigen Böen bringen die Robusta ins Rutschen. Nach dem dritten Umankern ist dann gut.
Drew und John wecken uns als sie bei Sonnenaufgang aufbrechen. Wir warten noch zwei Stunden bis sich der Südwind doch noch etwas beruhig und die See nicht mehr über die Mole kracht. Der erste Schlag ist hart. Mit Sturmfock und Grosssegel im dritten Reff, stampft die Robusta flott in die vom vorangegangenen Sturm aufgewühlte See. Beim Cape Flattery, spritzt die Brandung eindrücklich den Felsen empor. Doch der Spass hält nicht wie gedacht an. Statt wie im Wetterbericht prognostiziert sollte der Wind am Nachmittag langsam über Ost nach Nord drehen. Der bilderbuchmässige Drall bleibt aus. Zwei qualvolle Tage ohne Wind folgen. Mit Drew und John stehen wir per Funk im Kontakt. Sie motoren. Ihre Position liegt etwa 100 Seemeilen weiter südlich. Zur Belohnung erwischen sie den Nordwind früher. Drei Tage um die 30 Knoten. Die beiden leiden. Inklusive Kotzen. Unter Motor bei diesen Bedingungen Diesel verbraten, ist uns zu anstrengend. Das Schiff schaukelt extrem. Ohne Segel erst recht. Trotzdem sind wir beide nicht Seekrank. Haben wir noch nie erlebt. Mussten auch noch nie Medikamente einnehmen! Der Hunger wäre da, aber alles ist zu anstrengend. So stopfen wir halt je eine Schachtel Kekse liegend in uns hinein. Ich bekomme starke Kopfschmerzen. Das wohl weil mein untrainierter Nacken sich durch das Rollen komplett versteift hat. Ich bin kaputt. Geschlissen. Thomas übernimmt alles. Sogar die Fütterung des Monsters. Ich schäme mich.
Unter Segel ist alles wieder angenehmer. Doch im folgendem Wetterbericht poppt da ein Tief direkt vor uns auf. Ein kleiner Keil mit Lila Auge. Lila – eine Farbe auf der Wetterkarte, die kein Segler mag. Ausweichen geht nicht mehr. Jetzt aber Schotten dicht! Schwimmwesten mit Sicherheitsleinen anlegen. Reff ins Gross binden, Klüver weg. Sturmfock steht schon. Innen nochmals kontrollieren, ob alles gesichert ist. Seeventile zu, Lüfter schliessen! Es ist kalt. 10 Grad. Das Wasser etwa gleich. Über Bord gehen ist verboten! So unser Motto. Die Windsteueranlage arbeitet grossartig. Es ist so dunkel wie in einem Kuhmagen. Der Regen, der so dringend an Land erwartet wird, prasselt wie ein Wasserfall in die See. In der Robusta ist es laut wie wenn jemand eine Toilette spült. Thomas hat es sich mit seiner Matratze so halbwegs am Boden bequem gemacht. Mich hats gerade aus der Koje quer durchs Schiff geschmissen. Paar Beulen – sonst nichts. Hat die Kopfscherzen jedoch nicht gerade gelindert. Ich muss aufs Klo. Akrobatik pur ist angesagt. Mit einer Hand sich von der Wand wegstemmend die Hosen runter kurbeln – auf den Thron klettern – später wieder Hosen rauf und am besten vorher noch die nun gefährlich schwappende gelbe Suppe abpumpen. Es wird zu heftig. Beidrehen. Das Manöver gelingt nicht auf Anhieb. Die anrollenden Wellen drücken den Bug wieder auf die andere Seite. Doch nun liegt die Robusta für die Verhältnisse relativ ruhig und stabil, mit etwa vier Knoten driftend in der See. Die Wanten singen und flössen mir dabei ungute Gefühle ein. Die Robusta neigt sich so weit zur Seite, dass Wasser ins Cockpit strömt. Thomas brüllt das Gross muss weg! Deckslicht an, ich leuchte Zusätzlich mit der Taschenlampe. Die Sicherheitsleine ist verheddert. Dann sehe ich Thomas nicht mehr. Habe ihn doch nur für einen kleinen Augenblick aus den Augen gelassen um einen Blick auf die Windanzeige zu werfen. Nun kommt die Filmrolle aber ins spulen. Die Mann über Bord Taste zu drücken, ist mir so spontan nicht in den Sinn gekommen. Ich war wie paralysiert. Aus den abscheulichen Gedankennebel poppe ich raus, als durch das Getose der Befehl Reffleinen dicht, schwach erkennbar durchdring. Zwei Minuten, nicht mehr, aber so viele Gedanken schossen durch meine Gehirnwindungen und lösten dabei einen Heulkrampf aus – aber erst als alles wieder unter Kontrolle war. Das ist das erste mal wo ich mich so derart mies gefühlt habe. Nicht seekrank. Oder vielleicht doch? Nach einigen Stunden, so mit nun nur noch 30 Knoten Wind, beruhige auch ich mich wieder und mache mich ans Aufräumen. Thomas hat jetzt eine Pause verdient. Im Spülbecken stapelt sich das Geschirr der letzten Tage. In der Bilge schwappt eine braune Brühe. Herkunft noch unklar. Die Farbe erinnert an nichts schönes. Im Klo herrscht Chaos pur. Die Schapps sind sozusagen leer. Der Inhalt des Mülleimers, hauptsächlich aus Klopapier bestehend, liegt vermischt mit Zahnbürsten, Shampoo, Creme, Tücher und Waschlappen und Jacken am Boden. Immerhin trocken. Oelzeug und haufenweise nasse Klamotten liegen verstreut rum. Polster sind auch Nass. In der einen Decke klebt noch ein angeknabbertes Nutellabrot. Das Leintuch weist durch den ausgeschütteten Kaffee eine neue Musterung auf.
Der nächste Wetterbericht passt echt wieder überhaupt nicht ins Konzept. Wind von Süd direkt auf die Nase! Der Beschluss fällt schnell. Crescent City liegt 60 Seemeilen querab. Die Küste ist zwar mit vorgelagerten Felsen gespickt, die Hafeneinfahrt ist jedoch gut anzulaufen. So stets jedenfalls im Führer beschrieben.